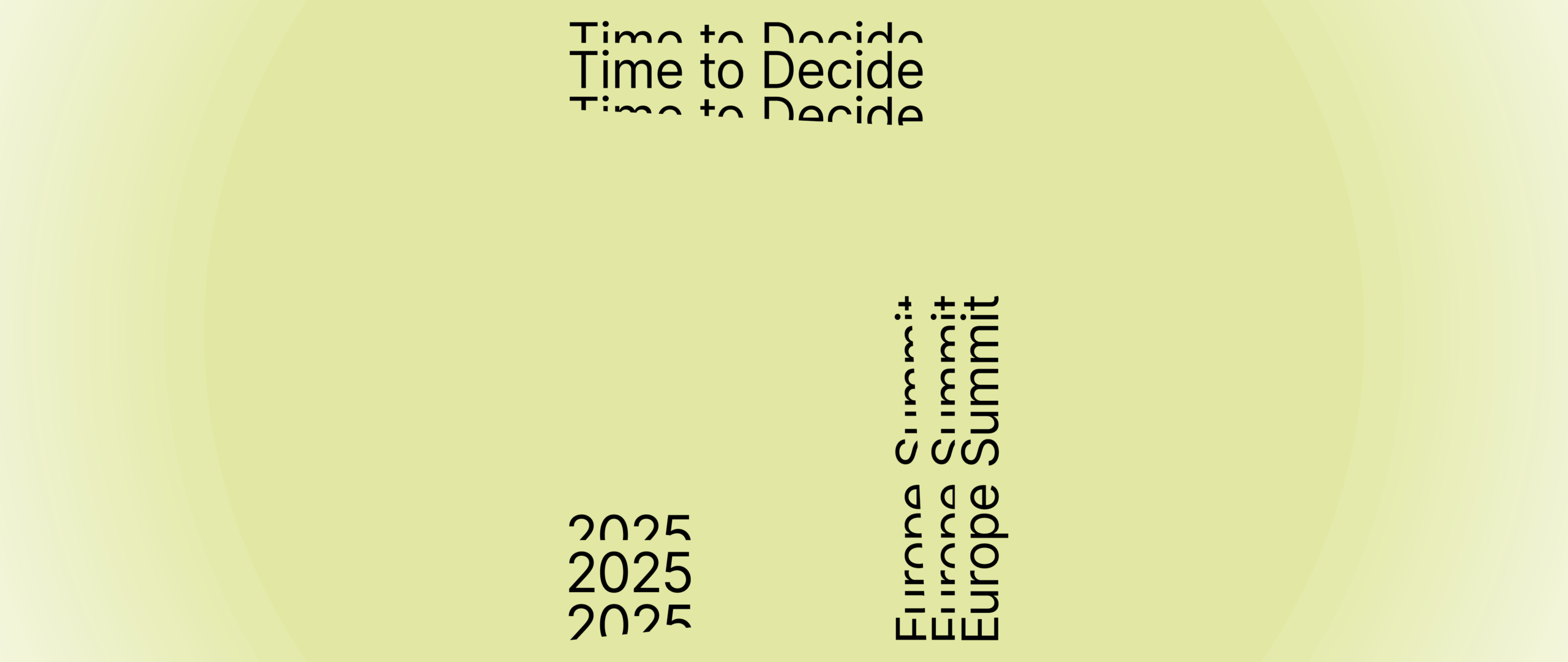Journal
4. November 2025
Lesezeit: 10'

Drei Fragen an Alexander Schallenberg
Alexander Schallenberg, ehemaliger Bundeskanzler und Außenminister der Republik Österreich, ist Präsident der Europe’s Futures Initiative – EFI.
ERSTE Stiftung Europa befindet sich inmitten einer multipolaren Krise: von wachsenden geopolitischen Risiken und Konflikten über die Zunahme populistischer Bewegungen bis hin zu rasanten gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen. Steht Europa tatsächlich an dem viel diskutierten Scheideweg? Und falls ja – wie können wir die richtige Richtung zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, einschlagen?
Alexander Schallenberg »Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.« Ich denke, dieser häufig zitierte Satz aus Lampedusas Roman »Der Leopard« fasst die aktuelle Lage Europas treffend zusammen. Im Wesentlichen geht es darum, zu erkennen, wie eng Geopolitik und Wirtschaft miteinander verflochten sind: Ob es sich nun um die Instrumentalisierung der Energie als Waffe durch Präsident Putin handelt, Chinas aggressive Industriepolitik, die Einführung von Zöllen unter Präsident Trump oder sogar scheinbar kleinere Probleme wie die Raketenangriffe der Huthi auf Handelsschiffe im Roten Meer, die eine faktische Bedrohung für die maritime Lieferkette darstellen.
Angesichts der Rückkehr zur Großmachtpolitik und zu militärischen Abhängigkeiten muss Europa wirtschaftlich unabhängiger werden, sich selbst verteidigen können und außenpolitisch entschlossener auftreten. Der jüngste Appell der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, für die Zukunft Europas zu kämpfen, war ausschlaggebend dafür, eine realistischere, pragmatischere Außenpolitik für Europa auszuarbeiten, die auf klaren Gegenleistungen beruht. Ich begrüße dies und bin überzeugt, dass wir Europäerinnen und Europäer das Zeug dazu haben, uns in diesem neuen Umfeld erfolgreich zu behaupten. Wir müssen jedoch mit Bedacht vorgehen, wenn es darum geht, unsere wirtschaftliche Stärke mit unserer Soft Power und Hard Power in Einklang zu bringen.
In erster Linie bedeutet dies eine Diversifizierung unserer Partnerschaften. So gesehen könnten sich Trumps Zölle unverhofft als Segen für Europa erweisen. Denn im Gegensatz zur unberechenbaren Wirtschaftspolitik des Weißen Hauses erscheint Brüssel als Anker der Stabilität. Von Tag zu Tag steigt die Zahl der Länder und internationalen Wirtschaftsorganisationen, die zur Stärkung der wirtschaftlichen Partnerschaften und politischen Zusammenarbeit aktiv auf die EU zugehen. Europa sollte diese Dynamik nutzen und potenziellen Partnern auf Augenhöhe begegnen – mit klaren Überzeugungen, aber ohne Arroganz. Unser Ziel muss es sein, Vertrauen aufzubauen und Kompromisse zu suchen. So verlockend es auch sein mag, Länder und Partner in die einfachen Kategorien »entweder für uns oder gegen uns« zu drängen, würde uns eine solche Haltung nur schwächen. Geopolitik funktioniert nicht wie Social Media. Man kann andere Länder nicht ghosten oder canceln. Geopolitik ist nicht schwarz-weiß, sondern besteht aus 5.000 Grautönen.
Zweitens gibt es auch Defizite, die wir direkt vor unserer Haustür angehen müssen. Dazu gehören beispielsweise die entschlossene Förderung des europäischen Kapitalmarkts und der Abbau von Handelshemmnissen innerhalb unseres Binnenmarktes. Laut Schätzungen des IWF belaufen sich die innerhalb des Binnenmarktes verbleibenden internen Barrieren auf das Äquivalent eines Zollsatzes von 45 Prozent auf Waren und 110 Prozent auf Dienstleistungen. Das sollte für uns alle ein Aufruf zum Handeln sein!
Das Gleiche gilt für unsere unmittelbaren Nachbarn. Ich spreche von den Westbalkanstaaten und ihren Beitrittsbestrebungen zur Europäischen Union. Wir müssen dieses geopolitische Erwachen der EU seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nutzen. Denn der Westbalkan ist nicht der Hinterhof, sondern der Innenhof Europas. Entweder gelingt es uns, für Sicherheit und Stabilität in unserer Nachbarschaft zu sorgen, oder wir werden mit einem wachsenden Einfluss dritter Akteure konfrontiert sein. In der Politik gibt es kein Vakuum. Der Westbalkan ist ein Lackmustest für die EU: Wenn wir hier versagen, werden wir geopolitisch in anderen Regionen an Glaubwürdigkeit verlieren.
»Der Westbalkan ist ein Lackmustest für die EU: Wenn wir hier versagen, werden wir geopolitisch in anderen Regionen an Glaubwürdigkeit verlieren.«
Zu guter Letzt muss Europa seine Verteidigung stärken. Doch auch hier gilt es zu erkennen, wie stark sich die Mentalität in Europa in den vergangenen Jahren bereits geändert hat – insbesondere was Investitionen in unsere Verteidigungsfähigkeit angeht. Gegenüber 2023 stiegen die Militärausgaben der EU-Mitgliedstaaten 2024 um 19 Prozent und die Verteidigungsinvestitionen um 42 Prozent. Diese Entwicklung dürfte sich 2025 fortsetzen. Das ist keine Kleinigkeit für einen Kontinent, der jahrzehntelang eine Art »Urlaub von der Geschichte« genossen hat und glaubte, dass die Friedensdividende ewig währen würde.
EF Die Europe’s Futures Initiative versteht sich als politischer Impulsgeber und Plattform für innovative, zukunftsweisende Lösungen. Was unterscheidet sie von anderen Thinktanks and wie kann sie Europa in Zeiten der Unsicherheit dabei unterstützen, neue Kraft zu schöpfen?
AS Ich sehe drei Kernpunkte, die die Europe’s Futures Initiative auszeichnen und mit denen sie auf einige bestehende Herausforderungen in diesem Bereich reagieren will: Relevanz, Zugang und Vision.
Erstens hat die EFI ihren Sitz in Wien, stützt sich jedoch auf ein dynamisches Netzwerk von Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Praxis aus aller Welt. Diese Mischung ist wichtig. Die EFI ist nicht als rein wissenschaftliches Projekt konzipiert. Vielmehr verbindet ihre Mitglieder eine gemeinsame Mission und ein Gefühl der Dringlichkeit: die Verteidigung und Stärkung liberal-demokratischer Werte und die Entwicklung relevanter, zeitnaher und praktikabler Politikempfehlungen. Kurz gesagt geht es nicht nur darum, ein Problem in einem 100-seitigen Bericht auf hundert verschiedene Arten zu analysieren, sondern zielgerichtete und konkrete Handlungsvorschläge für das weitere Vorgehen zu erarbeiten.
Zweitens muss Europa in einer Zeit, in der sich Sicherheitsordnungen verschieben und der Systemwettbewerb verschärft, rasch in seine geopolitische Rolle finden. Dafür braucht es Weitblick anstatt reflexartiger Reaktionen. Meine Erfahrung in der Regierung hat mich gelehrt, dass im politischen Alltag leider wenig Zeit bleibt, um langfristig in größeren Zusammenhängen zu denken – und genau das wäre jetzt so wichtig. Deshalb bin ich der Meinung, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gerade jetzt, da in Europa so viel auf dem Spiel steht, leichter auf das enorme Wissen und kreative Potenzial von Außenpolitikexpertinnen und -experten zugreifen können müssen, um Lösungen zu finden, die über die aktuellen Schlagworte hinausgehen. Anstatt den außenpolitischen Diskurs mit noch mehr Inhalten in Form von langatmigen Thinktank-Berichten zu füllen, will die EFI Fachleute und politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger direkt miteinander vernetzen.
Schließlich erkennt die EFI an, dass die Zukunft Europas nicht allein auf militärischer Stärke, sondern ebenso auf intellektueller Widerstandskraft beruht. Hier geht es um das »F«, die »Futures« (Zukunft) in der EFI. Das Schlimmste wäre, wenn die Europäerinnen und Europäer jetzt in Selbstzweifel und Resignation verfielen. Als Außenminister konnte ich auf Konferenzen in aller Welt beobachten, wie die Staats- und Regierungschefs des globalen Südens etwa beim Raisina-Dialog oder beim Sir-Bani-Yas-Forum die Frage stellten: »Welche Zukunft wollen wir?« Bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder dem Weltwirtschaftsforum lautete die Frage hingegen: »Haben wir überhaupt noch eine Zukunft?« Natürlich haben wir die! Und wir müssen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Das bedeutet, dass wir die Zukunft nicht den Untergangspropheten und Randfiguren überlassen dürfen, die aus den Ängsten und Zweifeln der Menschen Kapital schlagen, uns einreden wollen, unser System sei gescheitert, und Zwietracht säen. Das heißt, dass wir jenen Einflüssen widerstehen müssen, die die Narrative unserer Feinde bewusst übernehmen und gegen ein starkes und geeintes Europa arbeiten. All dies mit dem Ziel, unsere Lebensweise durch ihre Modelle zu ersetzen, seien es chinesische, russische oder andere.
Deshalb sieht sich die EFI auch in der Verantwortung, den Diskurs über Expertenrunden und Machtzentren hinaus mitzugestalten und den Europäerinnen und Europäern eine andere Erzählung anzubieten: eine, die uns mit Stolz auf unsere offenen und pluralistischen Gesellschaften und mit mehr Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft blicken lässt.
EF Da wir gerade von Zukunft sprechen: Wo sehen Sie Europa in den nächsten zehn Jahren? Wie können Projekte wie die Europe’s Futures Initiative dazu beitragen, dass Europa seine demokratischen Grundlagen weiter festigt, noch widerstandsfähiger wird und auf der globalen Bühne wettbewerbsfähig bleibt?
AS Meiner Ansicht nach haben es sich die Europäerinnen und Europäer in den letzten dreißig Jahren sehr bequem gemacht und eine Art »Urlaub von der Geschichte« genossen. Wir dachten, wir würden in einem posthistorischen und postnationalen Paradies leben – unberührt von Konflikten und Krieg. Wir gingen davon aus, dass die Friedensdividende ewig halten würde und dass wir unsere eigene Zukunft kennen würden. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass wir wieder genau dort sind, wo der Rest der Welt schon immer war. Wo die Zukunft nicht auf einem Silbertablett serviert wird, sondern unübersichtlich und chaotisch ist. Das ist ein ziemlich böses Erwachen, insbesondere angesichts der Rückkehr des Krieges auf unserem Kontinent. Die Zukunft ist jetzt etwas, das wir trotz aller Hindernisse und Krisen aktiv gestalten müssen. Und es gibt kein Zurück zum Status quo ante. Selbst wenn Putin morgen beschließen würde, seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Anstatt der Vergangenheit nachzutrauern, sollten wir als Europäerinnen und Europäer unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen und Widrigkeiten in Chancen verwandeln.
Ich verstehe nur allzu gut, dass das beunruhigend, ja sogar beängstigend sein mag. Aber ich glaube, dass dies auch ein äußerst befreiender und produktiver Moment für Europa sein kann.
Sehen wir uns die Wurzeln des Wortes »Krise« an – das griechische »krinein«: Es bedeutet trennen, auswählen, entscheiden. So unangenehm die Gegenwart auch sein mag, Krisen trennen die Spreu vom Weizen. Sie zeigen uns, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. In einer Zeit wie dieser steckt enormes Potenzial – und sie ist aufregend zugleich. Genau das hat auch die EFI inspiriert und erklärt, warum sie von Anfang an zukunfts- und handlungsorientiert war. Gerade in Zeiten des Umbruchs, in denen so viele Gewissheiten wegzubrechen scheinen, erkennen wir, was uns wirklich wichtig ist, aber auch worauf wir verzichten können. Wir können uns von alten Dogmen, Vorgehens- und Denkweisen befreien, die unserer Gesellschaft heute vielleicht nicht mehr so gut nützen wie früher.
Am allerwichtigsten ist jedoch, dass wir, selbst wenn unsere liberalen demokratischen Gesellschaften unter Druck stehen – sei es wirtschaftlich, politisch oder gesellschaftlich –, den Glauben an uns selbst und an unsere Zukunft nicht verlieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Europäerinnen und Europäer allen Grund zur Hoffnung haben. Und das sage ich nicht aus blindem Optimismus, sondern aufgrund meiner Beobachtungen während meiner Amtszeit als Außenminister und Bundeskanzler. Ganz gleich, was auf uns zukam – von der Covid-Pandemie über die Energiekrise bis hin zum russischen Angriffskrieg –, Europa hat sich als stärker, flexibler und widerstandsfähiger erwiesen, als wir geglaubt haben. Das sollte uns Mut machen und zuversichtlich stimmen.
Ich glaube, dass die EFI genau zum richtigen Zeitpunkt entsteht. In einer Zeit, in der Europa Gefahr läuft, durch Krisen gelähmt und in eine reaktive Politik gedrängt zu werden, müssen wir all unsere Intelligenz, Expertise und Innovationskraft mobilisieren, damit unsere Kinder und Enkelkinder auch in 10, 20 oder 30 Jahren in einer ebenso freien Gesellschaft aufwachsen können, die auf Demokratie, Pluralismus und individuellen Rechten basiert.
Titelbild: Michael Gruber